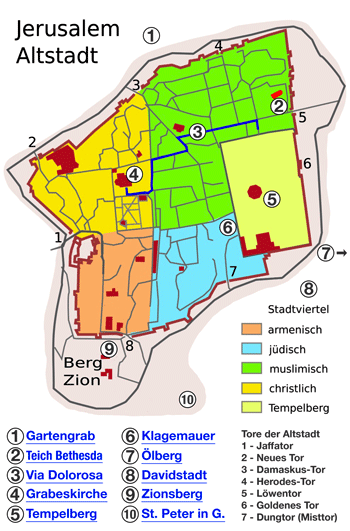

Der Blick vom Ölberg auf das Panorama Jerusalems ist ein unbedingtes »Muss« für jeden Israel-Besucher. In den Abendstunden glüht die Stadt in einem Sonnenuntergang, der ihre Umrisse wie funkelnde Edelsteine mit einem Hauch von Ewigkeit erstrahlen lässt.
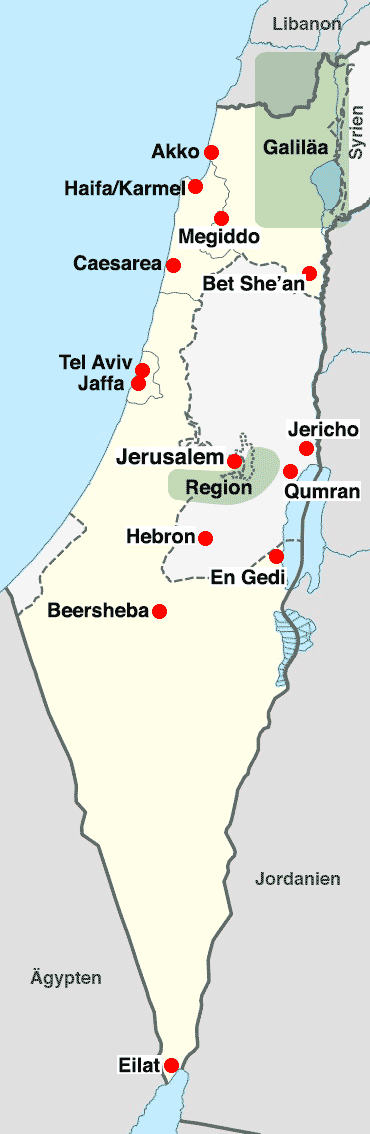
Atemberaubender Blick
Der Panoramablick vom gewiss bekanntesten Berg Israels ist schlichtweg atemberaubend und darf auf keiner Reise fehlen.
Der östlich der Altstadt vorgelagerte Ölberg erhebt sich zwischen dem historischen Jerusalem und der Wüste Judäas. Als höchster Punkt der Stadt (840m) ist er zugleich die höchste Erhebung des judäischen Berglandes in der Region von Jerusalem.
Seit ewigen Zeiten verändert der alte Höhenzug gegenüber dem Tempelberg ständig sein Gesicht – er bietet den weitesten Blick Jerusalems, ist ein Berg der Sehnsucht, der Erwartung, Hoffnung und Erlösung. Wie in der Vergangenheit hat der Berg auch heute noch einen großen Bestand an Ölbäumen, zwischen denen sich bezaubernde grüne Flecken, idyllische Pfade und vor allem überraschende Aussichtspunkte verbergen.

Eleona-Basilika / Paternoster-Kirche
Der Ölberg ist der traditionelle Ort, an dem der Himmelfahrt von Jesus gedacht wird. Neben der russischen Himmelfahrtskirche und der kleinen Himmelfahrtskapelle finden sich die Ruinen einer konstantinischen Basilika, der ersten Kirche auf dem Ölberg (griech. Eleona), auch "Kirche der Jünger" genannt. Sie wurde 325 über einer Höhle gebaut, die als Ort der Jüngerlehre und der Himmelfahrt Jesu galt, und die von nun an die Krypta der Kirche bildete. Schon in vorbyzantinischer Zeit (etwa 312) erwähnt Bischof Eusebius von Caesarea diese Grotte: "Die Füße des Herrn standen auf dem Ölberg an der Höhle, die man dort zeigt. Dort hat er gebetet und seinen Jüngern die Geheimnisse des Weltendes geoffenbart und ist von der dortigen Spitze des Ölbergs in den Himmel aufgefahren" (Demonstr. Evang. VI,18).
Gegenüber dem Tempel gelegen, auf dem Südgipfel des Ölbergs, halbwegs zwischen Jerusalem und Bethanien, diente die Grotte der Tradition nach Jesus als Unterschlupf. "Er lehrte des Tags im Tempel; des Nachts aber ging er hinaus und blieb an dem Berg, den man Ölberg nennt" (Lk 21,38). Während Jesus auf das Kommen seiner Stunde wartete, konnte er im Frieden in dieser Höhle (7x6m, 3m hoch) verweilen und seine Jünger lehren. Eine solche Existenz wurde von den geistlichen "Altvätern" der Wüste aufgenommen, die drei Jahrhunderte später ebenfalls in einsamen Höhlen lebten und dort ihre jüngeren Mitbrüder unterrichteten.

Vaterunser-Kirche
An diesem Ort dürfte Jesus in der Dienstagnacht vor seiner Kreuzigung den Jüngern die eschatologischen Reden gehalten haben, die von den Synoptikern wiedergegeben werden (Mt 24 und 25, Mk 13, Lk 21). In der einen prophezeit er die baldige Zerstörung des Tempels und Jerusalems; in der anderen kündigt er an, dass er am Ende der Zeiten zurückkehren wird, um alle Menschen zu richten. Von diesen besonderen Offenbarungen rührt auch der Name "Grotte der Erleuchtung" her.
Mit der Grotte wird zudem die Überlieferung verbunden, dass Jesus hier seinen Jüngern mitgab "alles, was er von seinem Vater gehört hat" (Joh 15,15) und seine Abschiedsreden (Joh 14-17) hielt.
Neun Jerusalemer Bischöfe fanden als Nachfolger der Jünger in den Nischen der Grotte ihre letzte Ruhestätte, darunter der bekannte Kirchenvater Cyrill von Jerusalem, der 386 starb.
Nach der persischen Zerstörung wurde die Kirche ab 1920 wieder aufgebaut. Aber der Kirchenbau wurde nie vollendet, da die verfügbaren Geldmittel bald erschöpft waren. Das Besondere sind die ca. 70 Übersetzungen des "Vater unser" auf armenischen Fayencetafeln.
Himmelfahrtskapelle
Im 4. Jahrhundert baut nach der Überlieferung Poemenia, eine reiche Jerusalemer Christin, eine oktogonale Kirche. Sie wird 614 von den Persern zerstört, aber auf den alten Fundamenten wieder aufgebaut. 1187 wird die Anlage in eine Moschee umgewidmet. Die Mittelkapelle erhält um 1200 eine Kuppel.

Diese kleine Kapelle in der Mitte eines achteckigen Hofes markiert die Stelle der Himmelfahrt Jesu 40 Tage nach seiner Auferstehung. Im Innern der Kapelle (am Eingang klingeln) kann man eine Fußspur erkennen, die Jesus zugeschrieben wird. Obwohl dies heute eine Moschee ist, dürfen am Himmelfahrtstag die verschiedenen christlichen Kirchen ihre Gottesdienste hier feiern, weshalb auch verschiedene Altäre im Hof zu finden sind.
Östlich der Himmelfahrtskapelle liegt das russische Himmelfahrtskloster, dessen 60 m hoher Turm das gesamte Gebiet beherrscht. Es ist für Besucher gewöhnlich geschlossen.
Dominus Flevit
Wer kennt ihn nicht, den Postkartenblick auf Jerusalem schlechthin: durch das Bogenfenster von Dominus Flevit (der Herr weinte) auf die gegenüberliegende Altstadt mit der Goldkuppel des Felsendoms - millionenfach fotografiert.
Die Franziskanerkapelle wurde 1954 über den Fundamenten einer Kirche des 5. Jahrhundert, von der links des Eingangs ein Mosaik enthalten ist, vom italienischen Kirchen-Architekten Antonio Barluzzi (1884-1960), der als Franziskanermönch ein einfaches, zurückgezogenes Leben führte, erbaut.
Während der Bauarbeiten hat man jüdische Gräber wie auch eine römisch-byzantinische Nekropole freigelegt. Die gezeigten Knochengefäße aus Stein enthalten Gebeine von Menschen, die zuvor mit dem ganzen Körper andernorts begraben waren, später exhumiert und deren Gebeine in diesen Behältern erneut beigesetzt wurden. Manche von ihnen tragen Inschriften in hebräischer, aramäischer und griechischer Sprache.
Die Franziskanerkirche, deren Name "der Herr weinte" bedeutet, steht ungefähr an der Stelle, an der Jesus über die Stadt weinte und ihre zukünftige Zerstörung voraussagte: "Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach: … denn es werden über dich die Tage kommen, dass deine Feinde werden um dich und deine Kinder einen Wall aufwerfen, dich belagern und an allen Orten ängstigen und werden dich schleifen und keinen Stein auf dem anderen lassen" (Lk 19,41-44). Diese Weissagung hat sich 40 Jahre später, als die Römer Stadt und Tempel in der Blüte der Prachtentfaltung dem Erdboden gleichmachten, auf bittere Weise erfüllt.

Die tränenförmige Kuppel soll an die Tränen Jesu über die bevorstehende Zerstörung der Stadt erinnern. Im Unterschied zu anderen Kirchen ist sie nicht nach Osten, sondern nach Westen ausgerichtet. Über dem großen Fenster mit dem berühmten Blick auf Jerusalem befinden sich Ornamente in Gestalt eines Tränenkelchs und der Dornenkrone.
Jüdischer Friedhof am Ölberg
Jerusalem ist von Friedhöfen umringt, teils auf Friedhöfe gebaut. Viele Juden, die in New York oder Buenos Aires oder wo auch immer leben, reservieren sich schon lange vor ihrem Tod einen Platz auf einem der jüdischen Friedhöfe, bevorzugt am Ölberg, und sind bereit, einige Zehntausend Dollar dafür zu zahlen. Bei der Auferstehung einen Platz nahe am Tal Josaphat, wo Gott das Jüngste Gericht abhält, zu haben, kostet eben seinen Preis.
Der Ölberg wurde schon in der Jebusiterzeit um 2400 v. Chr. als Begräbnisstätte benutzt. Die ältesten Gräber liegen am Fuße des Kidron-Josaphat-Tales und berichten von biblischen Helden und Märtyrern - und von der Hoffnung, dass es nach dem Tod eine Auferstehung gibt. Biblische Gestalten wie Absalom und Propheten wie Sacharja liegen hier bestattet, aber auch Koryphäen unserer Zeit wie Rabbi Avraham Hacohen Kook, erster Oberrabbiner des neuen Israel; Elieser Ben Jehuda, Schöpfer des modernen Hebräisch (Iwrith); Menachem Begin mit seiner Frau Alisa, der Widerstandskämpfer und spätere Ministerpräsident; die deutsch-jüdische Dichterin Else Lasker-Schüler, deren Grab man nach 1967 wiederentdeckt hat, u.v.a.m. Beim Gang über den Friedhof wird man immer wieder an die Geschichte des Zionismus und des Staates Israel erinnert. "Gräber wie ausgesät. Begrabene Sehnsucht nach Zion, der Auferstehung harrend" - so empfunden beim Blick über die Gräberfelder.

Die Wahl dieses Hanges als Friedhof hatte mehrere Gründe: Die Juden begruben ihre Toten nach dem Reinheitsgesetz immer außerhalb der Stadtmauern. In Richtung Osten konnte sich die Stadt aufgrund des Kidrontales nicht ausdehnen. Laut jüdischer Überlieferung wird am Ende der Tage die Auferstehung am Ölberg beginnen, so dass die hier Begrabenen zuerst mit dem Messias in die Heilige Stadt einziehen.
Nach der Einnahme dieses Hangs im Zuge der Eroberung Ost-Jerusalems im Jahr 1948 verwendeten die Jordanier viele Grabsteine als Baumaterial. Man baute damit das auf dem Ölberg weithin sichtbare Hotel "Seven Arches", auch die mitten durch den Friedhof führende Straße nach Bethanien. Ein jordanisches Armeelager, das heute noch auf dem Weg nach Jericho zu sehen ist, wurde aus diesen Grabsteinen errichtet. Ein großes quadratisches Massengrab (s. orangefarbenes Schild) mit 48 Grabsteinen fällt besonders auf: hier liegen die letzten Verteidiger des jüdischen Viertels in der Altstadt, die trotz Aufbietung der letzten Kräfte das Viertel nicht halten konnten und kurz vor der Einnahme durch die Jordanier gefallen sind. Nachdem sie bis 1967 innerhalb des besetzten jüdischen Viertels an einem geheimen Ort begraben worden waren, wurden sie nach der Wiedervereinigung mit militärischen Ehren an dieser Stelle beigesetzt. Heute investiert Israel viele Millionen, um die zerstörten Gräber zu restaurieren. Leider demolieren Araber immer noch die jahrtausendealten Gräber.
